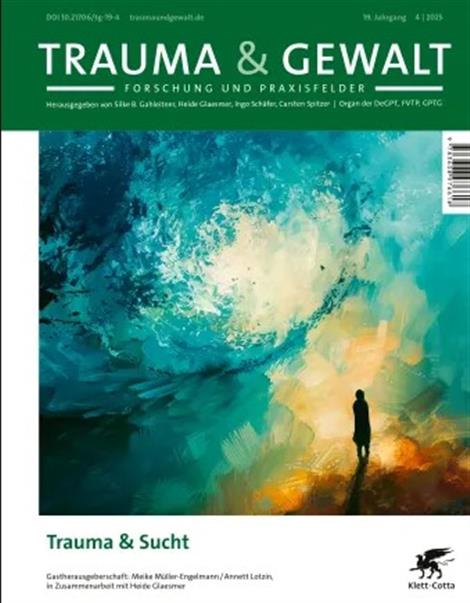
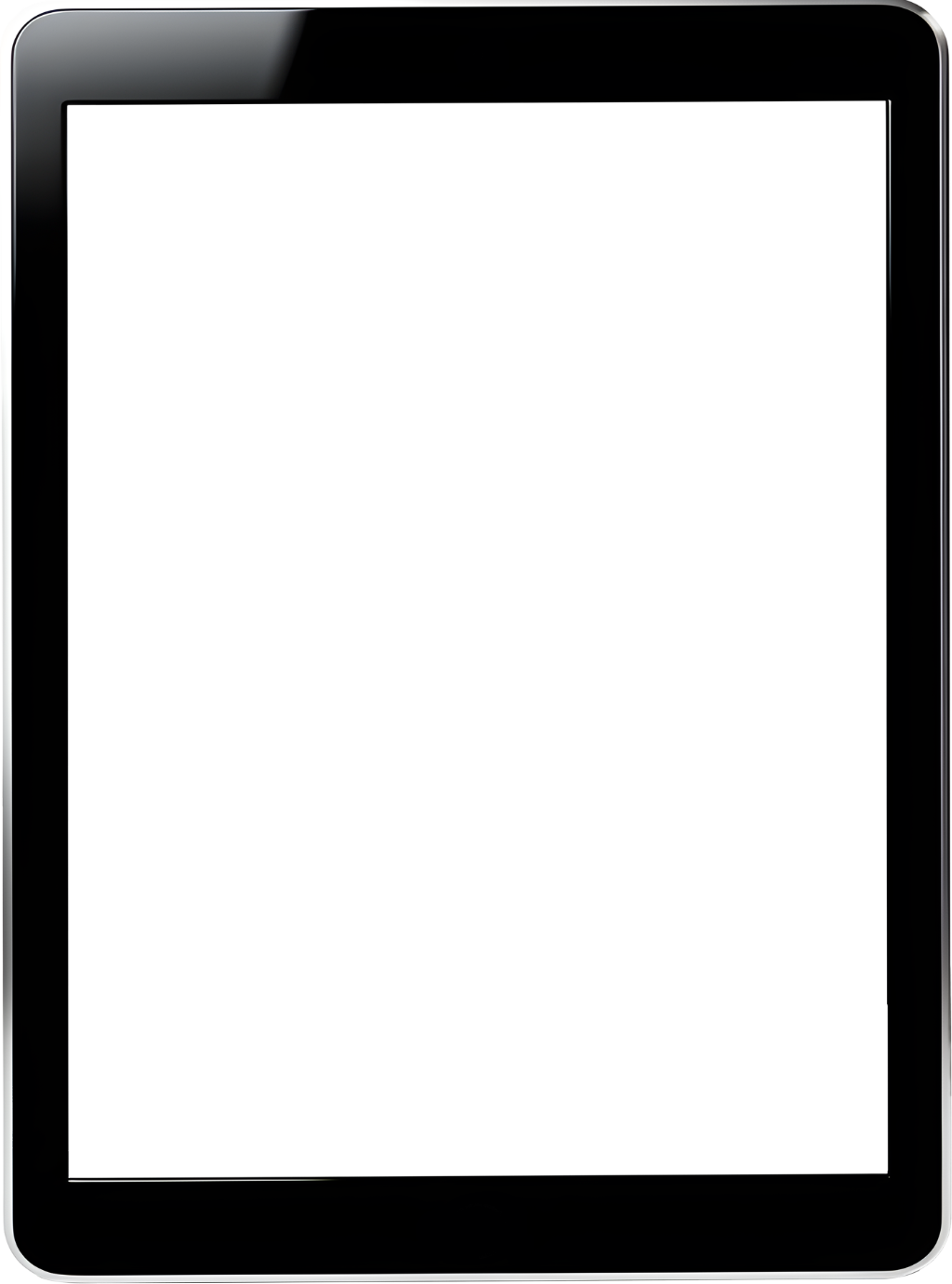

Ansätze zur Prävention und Behandlung bei komorbider Posttraumatischer Belastungsstörung und Substanzgebrauchsstörung
PTBS und Substanzgebrauchsstörungen treten oft gemeinsam auf. Frühzeitige kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen können beiden vorbeugen. Ein traumainformiertes Vorgehen erleichtert frühzeitige Identifikation und Weitervermittlung. Integrierte, traumafokussierte Therapien sind wirksam, sicher und berücksichtigen die Wechselwirkungen beider Störungsbilder in der Behandlung.
Eine Pilotstudie zur Prävalenz und zum Zusammenhang mit traumatischen Erlebnissen und der Posttraumatischen Belastungsstörung
Während des Entzugs treten bei 35 % der Patient:innen in der ersten und 16 % in der zweiten Woche psychotic-like experiences (PLE) auf. Ihr Auftreten korreliert mit Traumalast, früherem Delirium Tremens und PTBS. PLE könnten als Stressmarker für Verlauf und Outcome der Entzugsbehandlung dienen.
»Das ist wohl Ausdruck meiner Geschichte«
Komplexe dissoziative Störungen mit Stimmenhören, Identitätswechseln, Anfällen und Amnesien gehören zu den schwerwiegendsten psychischen Erkrankungen, bleiben aber oft unerkannt. Da evidenzbasierte Behandlungsprogramme fehlen, empfehlen sich traumafokussierte Multikomponentenansätze, erweitert um spezifische Module. Ein Fallbericht zeigt die 14-wöchige stationäre Psychotherapie einer Patientin mit pDIS, Anorexia Nervosa und PTBS.
Ein Update zu Epidemiologie, Ätiopathogenese und therapeutischen Herausforderungen
Konversions- bzw. funktionelle neurologische Störungen (FNS) äußern sich in pseudoneurologischen Symptomen ohne organische Ursache. Sie treten häufiger in Versorgungseinrichtungen auf, sind oft mit psychischen Störungen und erhöhter Suizidalität verbunden. Erklärungsmodelle kombinieren traumatische Erfahrungen, Stressfaktoren und neurowissenschaftliche Befunde, die eine gestörte Emotionsverarbeitung über veränderte neuronale Netzwerke nahelegen.
Historische Aufarbeitungsforschung: Plädoyer für einen emotionshistorischen Zugang
Der Beitrag plädiert für eine Ergänzung der historischen Aufarbeitung von Leid und Unrecht durch einen emotionshistorischen Zugang. So sollen Erfahrungen Betroffener sichtbar gemacht und in ihrer historischen Komplexität gewürdigt werden – jenseits juristischer Kategorien. Auch die emotionale Involviertheit von Historiker:innen soll reflektiert werden.
Bedeutung für das psychische und körperliche Befinden sowie das Unrechtserleben ehemaliger Heimkinder
Eine Fragebogenstudie mit 262 Menschen zeigt: Disziplinar- und Strafmaßnahmen waren in DDR-Kinderheimen weit verbreitet, besonders in Spezialheimen. Die meisten Betroffenen berichten mehrere Maßnahmen. Diese Erfahrungen stehen in Zusammenhang mit einem erhöhten Unrechtsempfinden und schlechterer psychischer wie körperlicher Gesundheit – ein wichtiger Befund für die Aufarbeitung dieses Kapitels der DDR-Geschichte.
Ansätze zur Prävention und Behandlung bei komorbider Posttraumatischer Belastungsstörung und Substanzgebrauchsstörung
PTBS und Substanzgebrauchsstörungen treten oft gemeinsam auf. Frühzeitige kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen können beiden vorbeugen. Ein traumainformiertes Vorgehen erleichtert frühzeitige Identifikation und Weitervermittlung. Integrierte, traumafokussierte Therapien sind wirksam, sicher und berücksichtigen die Wechselwirkungen beider Störungsbilder in der Behandlung.
Eine Pilotstudie zur Prävalenz und zum Zusammenhang mit traumatischen Erlebnissen und der Posttraumatischen Belastungsstörung
Während des Entzugs treten bei 35 % der Patient:innen in der ersten und 16 % in der zweiten Woche psychotic-like experiences (PLE) auf. Ihr Auftreten korreliert mit Traumalast, früherem Delirium Tremens und PTBS. PLE könnten als Stressmarker für Verlauf und Outcome der Entzugsbehandlung dienen.
»Das ist wohl Ausdruck meiner Geschichte«
Komplexe dissoziative Störungen mit Stimmenhören, Identitätswechseln, Anfällen und Amnesien gehören zu den schwerwiegendsten psychischen Erkrankungen, bleiben aber oft unerkannt. Da evidenzbasierte Behandlungsprogramme fehlen, empfehlen sich traumafokussierte Multikomponentenansätze, erweitert um spezifische Module. Ein Fallbericht zeigt die 14-wöchige stationäre Psychotherapie einer Patientin mit pDIS, Anorexia Nervosa und PTBS.
Ein Update zu Epidemiologie, Ätiopathogenese und therapeutischen Herausforderungen
Konversions- bzw. funktionelle neurologische Störungen (FNS) äußern sich in pseudoneurologischen Symptomen ohne organische Ursache. Sie treten häufiger in Versorgungseinrichtungen auf, sind oft mit psychischen Störungen und erhöhter Suizidalität verbunden. Erklärungsmodelle kombinieren traumatische Erfahrungen, Stressfaktoren und neurowissenschaftliche Befunde, die eine gestörte Emotionsverarbeitung über veränderte neuronale Netzwerke nahelegen.
Historische Aufarbeitungsforschung: Plädoyer für einen emotionshistorischen Zugang
Der Beitrag plädiert für eine Ergänzung der historischen Aufarbeitung von Leid und Unrecht durch einen emotionshistorischen Zugang. So sollen Erfahrungen Betroffener sichtbar gemacht und in ihrer historischen Komplexität gewürdigt werden – jenseits juristischer Kategorien. Auch die emotionale Involviertheit von Historiker:innen soll reflektiert werden.
Bedeutung für das psychische und körperliche Befinden sowie das Unrechtserleben ehemaliger Heimkinder
Eine Fragebogenstudie mit 262 Menschen zeigt: Disziplinar- und Strafmaßnahmen waren in DDR-Kinderheimen weit verbreitet, besonders in Spezialheimen. Die meisten Betroffenen berichten mehrere Maßnahmen. Diese Erfahrungen stehen in Zusammenhang mit einem erhöhten Unrechtsempfinden und schlechterer psychischer wie körperlicher Gesundheit – ein wichtiger Befund für die Aufarbeitung dieses Kapitels der DDR-Geschichte.
